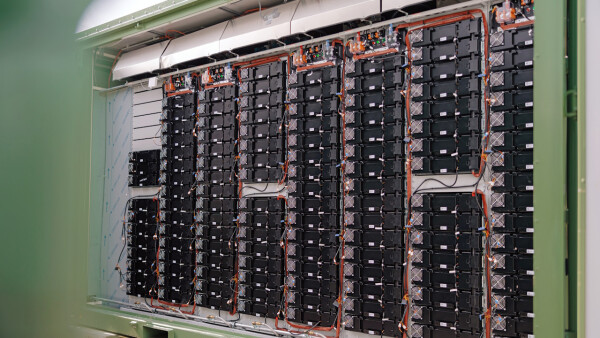7 Empfehlungen zum bidirektionalen Laden von Elektrofahrzeugen

Das erklärte Ziel der Bundesregierung ist es, Deutschland zum Leitmarkt der Elektromobilität zu machen. Eine der Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels ist die Ermöglichung von bidirektionalem Laden von Elektrofahrzeugen. Derzeit sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen für das bidirektionale Laden noch nicht ausreichend. Der bne zeigt im folgenden Papier auf, welche Möglichkeiten bidirektionales Laden bietet und was regulatorisch vom Gesetzgeber anzupassen ist.
Handlungsempfehlungen:
Stromsteuerbefreiung und Klarstellung zum Versorgerstatus
Befreiung von Abgaben und Umlagen bei zwischengespeichertem Strom
Netzentgeltvariabilisierung für V2G-Anwendungen
Austausch und Weitergabe notwendiger Datenpunkte
Messtechnische Vereinfachungen und praxistaugliche Steuerung
Abgrenzung von Grün- und Graustrom
Einheitliche Netzanschlussbedingungen für Ladeinfrastruktur
Für die täglichen Fahrten wird nur ein kleiner Teil der Batteriekapazität eines Elektrofahrzeugs verwendet. Elektroautos stehen die meiste Zeit. Die nicht genutzte mobile Speicherkapazität bietet in einem auf erneuerbaren Energien basierenden Energiesystem ein hohes Potential, wenn sie bidirektional laden kann, denn dies ermöglicht den Energieaustausch in zwei Richtungen.
Beim Vehicle-to-Home (V2H)-Anwendungsfall wird der Strom aus der Fahrzeugbatterie in das Gebäude bzw. an das Energiemanagementsystem zurückgeführt. Bidirektionales Laden ist somit eine Erweiterung des gesteuerten Ladens, bei dem beispielsweise tarifoptimiert Strom zu günstigeren Zeiten bezogen wird. Durch bidirektionales Laden kann in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage eigenständig sowie in Ergänzung mit einem Heimspeicher ein großer Grad an Eigenversorgung gewährleistet werden. Der Vorteil der Fahrzeugbatterie besteht darin, dass der zur Verfügung stehende Speicher nicht zusätzlich angeschafft werden muss, sondern einen weiteren Anwendungszweck erhalten kann. Dies wird gelegentlich auch „Vehicle to Building“ (V2B) bezeichnet.1
Beim Vehicle-to-Grid (V2G)-Anwendungsfall wird der Strom aus dem Elektrofahrzeug über die Wallbox in das Verteilnetz eingespeist. Das Elektrofahrzeug agiert somit als Teil des energiewirtschaftlichen Gesamtsystems und steht als flexible Leistung oder auch Last zur Verfügung. Denkbar sind Use Cases wie zeitliche Arbitrage, Primärregelleistung, lokale Netzdienstleistung oder Redispatch.2
Bidirektionales Laden wird diesen zentralen Zusatznutzen allerdings nur bieten, wenn die Umsetzung einfach, interoperabel und sicher erfolgt. Um eine solche interoperable Anwendung zu ermöglichen, müssen zahlreiche technische Regelwerke angepasst werden. Dazu gehören die Normen für die elektrische Sicherheit, z.B. IEC 61851 auf Seite der Ladeeinrichtung und ISO 5474-1/-2/-3 auf Fahrzeugseite sowie netzspezifische Regelwerke wie die VDE-AR-N 4100. Zu den betreffenden Normen für die digitale Kommunikation zählen ISO 15118-20 und IEC 63110.
Neben der technischen Standardisierung erschwert vor allem der aktuelle gesetzliche Rahmen die schnelle wirtschaftliche Umsetzung bidirektionalen Ladens. Dies wird vom Gesetzgeber teilweise bereits adressiert, jedoch gibt es eine Reihe von Themenbereichen, die schneller und umfassender Änderungen bedürfen.
Der bne schlägt folgende Maßnahmen vor, um bidirektionales Laden zu ermöglichen:
1. Stromsteuerbefreiung und Klarstellung zum Versorgerstatus
Das Gesetz zur Modernisierung und zum Bürokratieabbau im Strom- und Energiesteuer-recht hat eine gute Grundlage geschaffen, die bürokratischen Probleme jedoch nur teilweise gelöst. Es werden klare Vorgaben geschaffen, die verhindern, dass Nutzer von E-Fahrzeugen zum Versorger und Steuerschuldner werden. Positiv zu bewerten ist die Klarstellung, dass für V2H-Anwendungsfälle, also die Rückspeisung vom Auto ins Haus, die Stromsteuer nur einmalig anfällt, und zwar beim Endverbraucher. Mit steigenden Zulassungszahlen gewinnt die öffentliche Ladeinfrastruktur ebenfalls an Bedeutung, so dass das bidirektionale Laden auch für andere Anwendungen als im Eigenheim mitgedacht werden muss. Vor dem Hintergrund der Energy Performance of Building Directive (EPBD), und dem daraus folgenden Ausbau von Ladeinfrastruktur bei Nichtwohngebäuden, sollte in der Legislative besonderes Augenmerk auf den Anwendungsfall “bidirektionales Laden beim Arbeitgeber” gelegt wer-den. Eine Entladung von Flotten- und von Mitarbeiterfahrzeugen kann einen signifikanten Beitrag zur Reduktion des notwendigen Netzausbaus leisten, wenn diese zur Lastgangkurvenoptimierung eingesetzt werden. Folglich reicht der Vorstoß im Gesetz zur Modernisierung und zum Bürokratieabbau im Strom- und Energiesteuerrecht nicht aus, da er aktuell keine Verbesserung für V2B - im Sinne von vehicle to business - und V2G - also die Rückspeisung ins Netz - Anwendungen mit sich bringt. Hier ist eine Überarbeitung im Sinn einer Ausweitung auf V2B im gewerblichen Umfeld sowie V2G notwendig.
2. Befreiung von Abgaben und Umlagen bei zwischengespeichertem Strom
Gefordert wird eine Befreiung von Ladepunkten von der Konzessionsabgabe, ähnlich zu der KWKG- und der Offshore-Umlage, für bezogenen Strom, soweit dieser wieder in ein Netz eingespeist wird. Nach § 21 EnFG ist zwischengespeicherter Strom von der KWKG- und der Offshore-Umlage befreit. Dies gilt für stationäre, wie für mobile Speicher über eine Saldierung der am Netzanschlusspunkt entnommenen und der eingespeisten Strommenge. Der bne empfiehlt, eine Ausweitung von § 21 EnFG auf die Konzessionsabgabe und ggf. die Stromsteuer für V2G-Anwendungen zu prüfen. Die Logik der Erhebung der Konzessionsabgabe ist ohnehin grundsätzlich reformbedürftig, da die überkommene Wälzung über gelieferte Kilowattstunden bei Prosumern und anderen neuen Anwendungen der Energiewende nicht mehr funktioniert.
3. Netzentgeltvariabilisierung für V2G-Anwendungen
Ein Vergütungsmodell für netzdienliche Flexibilität ist ein wichtiger Baustein für ein effizientes Energiesystem. Durch die Novellierung des § 14a EnWG hat die BNetzA den Einstieg in eine marktgestützte Beschaffung von Flexibilitätsdienstleistungen vorgezeichnet. Nach der Festlegung der BNetzA sind elektrische Speicher im Verteilnetz zu einer Teilnahme verpflichtet. Ab 2025 sollen dynamische Netzentgelte einen Anreiz bieten, den Verbrauch netzdienlich anzupassen.
Das Ziel muss jedoch sein, einen Marktrahmen zu entwerfen, der Nachfrage durch den VNB und Flexibilität durch wettbewerbliche Teilnehmer zusammenführt. Die Option der marktgestützten Beschaffung von Flexibilitätsdienstleistungen muss weiter gestärkt werden. So verpflichtet § 14c Abs. 1 EnWG Netzbetreiber zur marktgestützten Beschaffung von Flexibilitätsdienstleistungen im Verteilnetz. Die BNetzA kann dabei Spezifikationen für die Beschaffung von Flexibilitätsdienstleistungen und für standardisierte Marktprodukte vorgeben (§ 14c Absatz 3 EnWG). So ließe sich eine langfristig tragfähige und wirtschaftlich attraktive Lösung der Netzentgeltfrage für Speicher finden.
4. Austausch und Weitergabe notwendiger Datenpunkte
Die für die Umsetzung des bidirektionalen Ladens erforderlichen Datenpunkte müssen zwischen Fahrzeug- und Infrastrukturseite ausgetauscht werden. Zwingend erforderlich sind aus unserer Sicht technische Daten, die den Anforderungen der Normung entsprechen (etwa ISO 15118-20) sowie Daten, die den gesetzlichen Anforderungen entsprechen (z.B. RED III). Für das bidirektionale Laden ist der Zugriff auf eine Vielzahl von Fahrzeugdaten erforderlich, insbesondere SoC (state of charge), Batteriekapazität und SoH (state of health). Als wettbewerblicher Energiewirtschaftsverband setzt sich der bne für einen diskriminierungsfrei ausgestalteten Markt ein. Es muss ein Level-Playing-Field für möglichst viele Marktteilnehmer geben. Dafür müssen sämtliche relevanten Funktionalitäten sowohl durch die Automobilunternehmen als auch die Energiewirtschaft abgebildet werden können. Das Ziel der erfolgreichen Einführung bidirektionalen Ladens ist nur dann zu erreichen, wenn die Bedürfnisse der Anwenderinnen und Anwender im Mittelpunkt stehen und die Technologie praktikabel sowie interoperabel ist.
5. Messtechnische Vereinfachungen und praxistaugliche Vorgaben für die Steuerung
Für das bidirektionale Laden wird zukünftig eine Steuerung der Lade- und Einspeisevorgänge notwendig sein. Hohe Sicherheitsstandards sind notwendig, um die Versorgungs- und Systemsicherheit zu gewährleisten. Sicherheit ist aber nicht gleichbedeutend mit dem Einsatz des Smart Meter-Gateways. Die verpflichtende Verwendung der Datenübertragung über intelligente Messsysteme sollte auf ein praxistaugliches Minimum beschränkt werden. ERD im Sinne von § 19 MsbG werden weiterhin über das SMGW übermittelt.
Grundsätzlich müssen Speicher messtechnisch abgegrenzt werden, um ihre Flexibilität vermarkten zu können. Dies erfordert heute schon komplizierte Messkonzepte. Die Messkosten für komplexe Lieferstellen übersteigen in vielen Fällen ihren wirtschaftlichen Nutzen. Für mobile Speicher ergeben sich neue Anforderungen an die Messung, die von der Architektur intelligenter Messsysteme ohnehin nicht abgedeckt werden können. Diese sind auf den Einsatz in stationären Anlagen und nicht für den stetigen Wechsel von Speichern und Marktpartnern ausgelegt. Sowohl bei Untermessungen als auch bei den Anforderungen an die ein-gesetzte Messtechnik müssen daher pragmatische Wege beschritten werden. Bestehende Kommunikationskanäle und Messgeräte müssen mit Blick auf Kosten und Praktikabilität weiterhin Verwendung finden, bspw. MID-Zähler.
6. Abgrenzung von Grün- und Graustrom
Die Beladung von Elektrofahrzeugen erfolgt in der Regel an verschiedenen Ladepunkten. Die Abgrenzung von Grün- zu Graustrom ist daher komplizierter als bei stationären Speichern. Stromspeicher, die als EEG-Anlage gelten, beispielsweise in Verbindung mit einer PV-Anlage, erhalten das Privileg der vorrangigen Stromabnahme ebenso, wie das Privileg der EEG-Vergütung. Sobald Graustrom in die Fahrzeugbatterie geladen wird, gilt das Ausschließlichkeitsprinzip und damit der Verlust dieser Privilegien. In diesem Zusammenhang ist es zu begrüßen, dass mit den vorgesehenen Änderungen des § 19 EEG die flexiblere Nutzung von Speichern ermöglicht werden soll. Diese Regelung ist auch auf mobile Speicher anzuwenden.
In der vorliegenden Form besteht jedoch insbesondere durch unnötige prozessuale Anforderungen die Gefahr, dass die Änderung absehbar keine praktische Wirkung entfalten kann. Nicht ersichtlich ist dabei insbesondere der Vorbehalt einer Festlegung durch die BNetzA (§ 85d EEG) für die in § 19 Abs. 3a EEG vorgesehene Regelung, die einen Wechsel des Speicherbetriebs bis zu fünfmal im Jahr für Perioden von mindestens je zwei Monaten vorsieht. Die Festlegung soll erstmalig bis zum 30. Juni 2025 getroffen werden. Damit wäre die Umsetzung des genannten Speicherbetriebs erst frühestens in über einem Jahr möglich. Dabei könnten die technischen und prozessualen Anforderungen zur Umsetzung des vorgesehenen Modells bereits heute erfüllt werden.
7. Einheitliche Netzanschlussbedingungen für Ladeinfrastruktur
Die nach §14e EnWG geforderte Einführung einer gemeinsamen Internetplattform der Netzbetreiber für Anschlussbegehren ist ein wichtiger Schritt in Richtung von Bürokratieabbau und Vereinheitlichung der Antragsverfahren. Um den Bedürfnissen der überregional tätigen Marktteilnehmer gerecht zu werden, sind jedoch weitere Vereinfachungen und Vereinheitlichungen notwendig. Dies beinhaltet bundesweit einheitliche Formulare und Verfahren sowie einheitliche technische Anschlussbedingungen (TAB). Darüber hinaus muss der gesamte Netzanschlussprozess von Energiewende-Technologien wie Ladepunkten umfassend digitalisiert werden. Aktuell ist zu befürchten, dass mit den Änderungen des § 8 Absatz 7 EEG sowie den bestehenden Regelungen des § 14e EnWG lediglich Verfahren rund um Netzanschlussbegehren digitalisiert werden sollen. Daher muss die gesetzliche Grundlage deutlich machen, dass die Anforderungen sämtliche Netzanschlussprozesse umfassen. Für Anmeldung und Anschluss der An-lagen sind aktuell weitere Schritte erforderlich, die hohe administrative Aufwände verursachen. Hier bietet die Digitalisierung noch einen großen Spielraum für Vereinfachungen und ein beschleunigtes Verfahren.
Quelle: bne