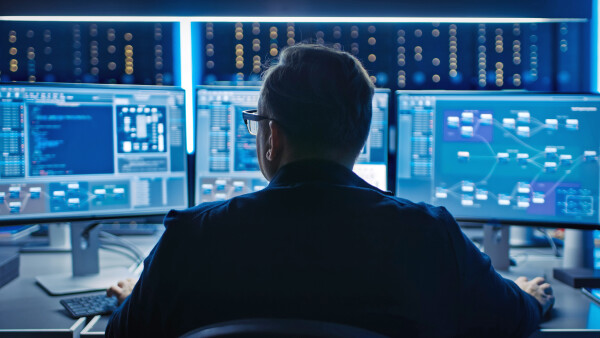Dinah TimmerhuesUTW Dienstleistungs GmbH
Dinah TimmerhuesUTW Dienstleistungs GmbH Antje KloppenburgHD-Technic GmbH
Antje KloppenburgHD-Technic GmbH Jonas Beseler8.2 QHSE GmbH & Co. KG
Jonas Beseler8.2 QHSE GmbH & Co. KG
Sicherstellen unverzüglicher Rettung

Das Land Schleswig-Holstein hat im Oktober 2023 angefangen, in einer gemeinsamen Kampagne mit dem Land Niedersachsen Betreiber von Onshore-Windenergieanlagen in Schleswig-Holstein anzuschreiben unter der Überschrift: „Sicherstellung einer unverzüglichen Rettung und medizinischen Versorgung von Beschäftigten.“ Dass die Anforderungen des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung auch in weitere Bundesländer ausstrahlen und dort übernommen werden, ist hoch wahrscheinlich. Die Forderungen im Schreiben haben ihre Berechtigung – die Umsetzung wird die Beteiligten allerdings noch deutlich vor Herausforderungen stellen.
Forderung
Das Land Schleswig-Holstein fordert vor allem die Kooperation zwischen allen Beteiligten:
„Damit diese gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden können, müssen alle Verantwortlichen – Arbeitgeber, Betreiber und der öffentliche Rettungsdienst – alle notwendigen Maßnahmen in einem abgestimmten Rettungskonzept darstellen.“
Der Begriff „unverzüglich“ wird im Schreiben durchaus definiert – gemeint ist eine medizinische Versorgung von verletzten Personen spätestens 30 Minuten nach dem Notruf. Damit die verletzte Person entsprechend versorgt werden kann, ist es notwendig, dass entweder die betroffene Person die WEA verlassen (selbständig oder mit Hilfe der/des Kollegen vor Ort) und medizinischem Personal übergeben werden kann oder aber das medizinische Personal die verletzte Person erreichen kann. Beides ist – je nach Schwere der Verletzung und Lage der verletzten Person – eine kaum oder nicht zu bewältigende Herausforderung. Auch die beste Vorbereitung mit einem Rettungskonzept beschleunigt nicht die Fahrt mit der Befahranlage (normative Begrenzung max. 18 m/min), es beschleunigt nicht den Aufstieg in der WEA, und selbst bei optimaler Vorbereitung können wir nicht verhindern, dass die Rettungskräfte vielfach einen langen Anfahrtsweg zur WEA haben. Dabei ist noch nicht beachtet, dass die Rettungsdienste den Ein- und Aufstieg in eine WEA mit dem Hinweis auf Eigengefährdung verweigern können.
Die Gesamtanforderungen mögen erstmal erschlagend wirken, aber jeder Schritt, der gemacht wird, bringt mehr Sicherheit im Notfall. Eine gute Vorbereitung und eine enge Abstimmung mit potenziellen Rettern erleichtert den Rettungskräften die Arbeit und kann im Notfall viel Zeit sparen.
Grundvoraussetzungen
Eine Begehung des Windparks mit der örtlichen Feuerwehr und eine Einweisung in die Gegebenheiten des Windparks ist der erste Schritt und wird oftmals auch in Genehmigungen gefordert. Bereitstellen von Informationen für die Rettungskräfte wie z. B. Feuerwehrplan, Feuerwehrmappe und Einträgen ins WEA-NIS bzw. den Nachfolger DEEP sowie die Registrierung des Windparks bei den örtlichen Rettungsleitstellen machen im Notfall ein schnelleres Auffinden der WEA und eine schnelle Orientierung vor Ort möglich.
Eine Verfügbarkeit von Schlüsseln vor Ort, z. B. in einem Feuerwehrschlüsseltresor oder Feuerwehrschließsystem, erleichtert und beschleunigt den Zutritt zur WEA. Die Verfügbarkeit von geprüften mitlaufenden Auffanggeräten ist essenziell, damit Höhenretter die WEA besteigen können. Eine Einweisung in den Aufzug bzw. die Befahranlage ist notwendig, eine Kurzanleitung im Aufzug kann hier helfen, Klarheit zu schaffen und die Nutzung zu vereinfachen – die regelmäßige Prüfung der sicherheitsrelevanten Einrichtungen der WEA ist selbstverständlich Voraussetzung.
Ein Notabseilgerät im Maschinenhaus mit der richtigen Länge kann Leben retten. Das Mitführen von Notabseilgeräten durch begehende Personen ist bei 160 m Seil und 40 kg+ Gewicht unpraktikabel. Unter Berücksichtigung, dass neue WEA immer höher werden, ist zu beachten, dass die Seillänge vom Maschinenhaus bis zum Boden ausreichend bemessen sein muss – bei Wind wird das Seil vom Turm weggedrückt. Ein Zuschlag von ca. 15–20 % auf die Seillänge im Vergleich zur direkten Strecke erscheint hier deutlich erforderlich.
Übungen mit potenziellen Rettern sind wichtig und zielführend, um zum einen die (Höhen-)Retter mit den WEA vertraut zu machen und zum anderen auch von ihnen zu lernen. Wer eine Übung begleitet hat, wird schnell feststellen, wie eng Maschinenhäuser sind, wie schwierig die Bergung aus einer Nabe ist und wie deutlich die Hemmschwelle sein kann, sich durch die Kranluke einer 160 m hohen WEA abzuseilen.
Wichtig sind aber auch eine gut lesbare Kennzeichnung der WEA, damit Retter nicht erst im Windpark suchen müssen. Eine Listung der Anlage im WEA-NIS und dem zukünftigen DEEP (Decentralised Energies Emergency Platform) des FGW erleichtert die Beschaffung der Informationen, die Rettungsdienste benötigen.
Wer ist verantwortlich?
Zudem gilt, die Rettung durch Höhenretter aus einer WEA ist nicht Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge – was bedeutet: Es besteht kein Anspruch auf eine Höhenrettung durch Feuerwehr/Retter. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige, zusätzliche Leistung der Feuerwehren. Je nachdem, wo in Deutschland ein Windpark steht, können auch mehrere Stunden vergehen, bis zum Eintreffen der Höhenrettung.
Das Land Schleswig-Holstein spezifiziert hierzu: Rettungsmittel im Sinne des Schleswig-Holsteinischen Rettungsdienstgesetzes sind Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF), Verlegungsarzteinsatzfahrzeuge (VEF), Rettungswagen (RTW), Krankentransportwagen (KTW) und Rettungstransporthubschrauber (RTH).
Ob diese Regelung auch für das Bundesland zutrifft, in dem Ihre WEA steht, sollten Sie klären, es ist aber grundsätzlich davon auszugehen. Es ist die Verantwortung des Betreibers und des Arbeitgebers, dafür Sorge zu tragen, dass die zu rettende Person an die Rettungskräfte vor der WEA übergeben werden kann.
Das Ministerium in Schleswig-Holstein hat seinem Schreiben eine Checkliste beigefügt, es lohnt sich, diese einmal abzugleichen und nachzuarbeiten. Klarheit bringt zusätzlich noch die DGUV 203-007 Windenergie. Ansprechpartner für das Ministerium und die Gewerbeaufsichtsämter ist immer erst der Betreiber, weil dieser eindeutig bekannt ist. Eine Abstimmung mit Serviceunternehmen, Feuerwehr und Betriebsführung ist zur Erstellung eines stichhaltigen Rettungs-/Notfallkonzepts unerlässlich.
Dieser Beitrag erschien im Betreiberbrief 4-2024.
- Der Arbeitgeber muss gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. (…). Einzubeziehen sind dabei Maßnahmen zur Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit (§ 3 Abs. 1 ArbSchG), Maßnahmen zur Ersten Hilfe und Evakuierung (§ 10 Abs. 1 ArbSchG, DGUV Vorschrift 1) und Maßnahmen, die sicherstellen, dass Beschäftigte und andere Personen bei einem Unfall oder bei einem Notfall unverzüglich gerettet und ärztlich versorgt werden können (§ 11 Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV). Textstelle aus dem Schreiben des Minis-teriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung (Schleswig-Holstein) vom 27.10.24 Unter der Überschrift: ‚Arbeitsschutz auf Onshore-Windenergieanlagen: Sicherstellung einer unverzüglichen Rettung und medizinischen Versorgung von Beschäftigten‘.
- Textstelle aus dem Schreiben des Ministeriums für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung (Schleswig-Holstein) vom 27.10.24 Unter der Überschrift: ‚Arbeitsschutz auf Onshore-Windenergieanlagen: Sicherstellung einer unverzüglichen Rettung und medizinischen Versorgung von Beschäftigten.‘