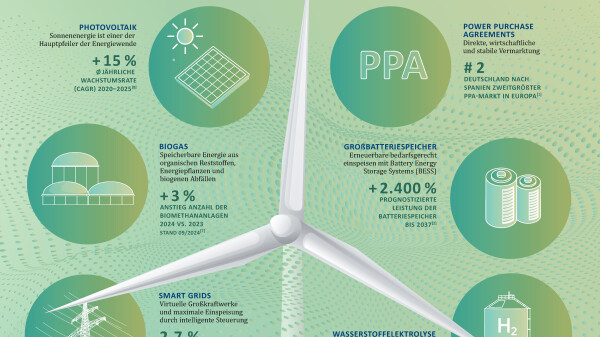Geothermie – Heiße Tiefenströme

Weit unten, in 1760 Metern Tiefe, durchzieht eine Wasserader die Sandsteinschichten des Neuruppiner Lands in Brandenburg. Das ist an sich kein Aufsehen erregender Fund. Doch in diesem Fall verhält es sich anders: 65 Grad heißes Wasser strömt dort durch den Untergrund. Und „mehr davon, als wir gehofft hatten“, sagt Artur Dzasokhov, Technischer Leiter bei den Stadtwerken Neuruppin. Ideale Bedingungen, sagt er, um mit der Wärme aus der Tiefe bis zu 70 Prozent des Neuruppiner Fernwärmebedarfs über das existierende Wärmenetz zu decken.
Dazu wird das Tiefenwasser an zwei Bohrstellen an die Oberfläche befördert und mit Wärmepumpen noch etwas mehr aufgeheizt, auf knapp über 70 Grad Celsius im Sommer und rund 85 Grad im Winter. Ende 2026, wenn alle Testmessungen durchgeführt und alle Anlagen an der Oberfläche aufgebaut sein werden, soll das Geothermie-Projekt in Betrieb gehen.
Die 32 000-Einwohner-Stadt Neuruppin ist das jüngste Beispiel für den großen Wandel, der sich derzeit in der Wärmeversorgung Deutschlands abzeichnet. Bisher fristet tiefe Geothermie, die Erdwärme aus 400 bis 5000 Metern unter der Oberfläche nutzt, hierzulande ein Nischendasein. Aktuell gibt es 18 Anlagen im Großraum München und einige weitere am Oberrheingraben in Landau, Bruchsal und Insheim. Bundesweit finden sich vereinzelt weitere Erdwärme-Kraftwerke, die zur bescheidenen Gesamtleistung von derzeit gut 400 Megawatt beitragen.
Die Technik boomt
Dennoch stimmt der Blick auf eine jüngst vom Bundesverband Geothermie veröffentlichte Deutschlandkarte optimistisch (siehe Seite 32). Über das gesamte Bundesgebiet verteilen sich die Projekte. 16 Anlagen sind derzeit in Bau, weitere 155 in Planung. Alle Vorhaben haben ein Ziel: mit mal mehr, mal weniger tiefen Bohrungen eine – unter menschlichen Zeitmaßstäben – fast unerschöpfliche, stetig verfügbare und obendrein klimaneutrale Wärmequelle anzuzapfen. So ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich bis in die 2030er Jahre die aus dem Untergrund gewonnene Wärmeleistung in Deutschland vervielfachen könnte.
Lesen Sie den vollständigen Artikel kostenlos auf neueenergie.net: Heiße Tiefenströme