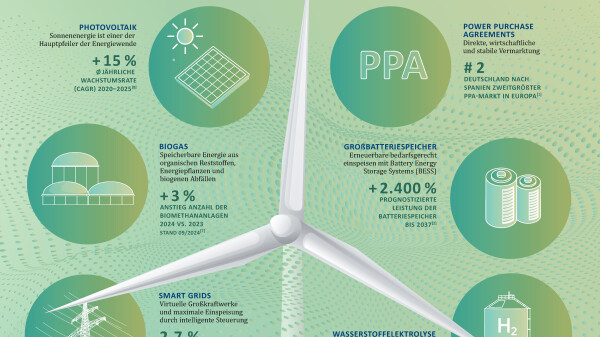Bioenergie in der kommunalen Wärmeversorgung

In den Umbau der Wärmeversorgung in Deutschland ist endlich Bewegung gekommen. Nachdem die gesetzlichen Rahmenbedingungen durch das Wärmeplanungsgesetz und das Gebäudeenergiegesetz geschaffen wurden, liegt der Ball nun bei den Ländern, Städten und Kommunen, die Wärmewende vor Ort umzusetzen. Während die Länder die Bundesgesetzgebung „nur“ in Gesetzesform gießen müssen, tragen Städte und Kommunen jetzt die Hauptlast und Verantwortung.
Bis zum 30. Juni 2026 müssen große Städte ihre Wärmepläne vorlegen, zwei Jahre später alle Kommunen unter 100.000 Einwohner*innen. Die Zeit drängt also und viele Kommunen sind schon in den nach Wärmeplanungsgesetz vorgeschriebenen Prozess gestartet.
Wichtig ist, dass die kommunalen Entscheider*innen frühzeitig die Weichen für eine wirklich klimafreundliche, naturverträgliche und langfristig günstige erneuerbare Wärmeversorgung stellen. Grüner Wasserstoff und Biomasse werden absehbar begrenzt verfügbar und teuer sein. Dagegen sind technologische Alternativen teilweise mit höheren Anfangsinvestitionen verbunden, zahlen sich jedoch durch niedrigere Betriebskosten und zukunftssichere Fernwärme aus.
Derzeit werden in Deutschland etwa die Hälfte aller Wohnungen mit Gasheizungen beheizt und ein Viertel durch Ölheizungen. Ein weiteres Achtel wird durch Fernwärme versorgt, die noch zum größten Teil aus Erdgas- und Kohlekraftwerken stammt. Leider erscheint der Ersatz von Kohle durch Holzbiomasse oft als der einfachste Weg, um die Fernwärme auf dem Papier klimaneutral zu machen. In Hannover, Berlin, Hamburg und Nürnberg zum Beispiel sollen Kohleheizkraftwerke künftig durch Holzverbrennung ersetzt werden. Doch Investitionen in neue Holz-Heizkraftwerke sollten dringend überdacht werden.
Nachhaltige Technologien für eine klimafreundliche Fernwärme
Solarthermie, Geothermie, Power-to-Heat und Großwärmepumpen zur Nutzung vorhandener Abwärme sind wirklich klimafreundliche Lösungen und garantieren langfristig verbraucherfreundliche Fernwärmepreise. Effizienz, Sanierung und Absenkung der Netztemperaturen, wo immer möglich, sind flankierend notwendig, um die Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung erfolgreich umzusetzen.
Grüner Wasserstoff, Müllverbrennung und Biomasse dürfen maximal zur Deckung der Spitzenlast an besonders kalten Tagen zum Einsatz kommen, wenn alle anderen erneuerbaren Technologien ausgeschöpft sind. Bei der Nutzung von Wasser, also Grund- und Oberflächengewässer, zur Gewinnung von Wärme bestehen noch Unsicherheiten bezüglich der ökologischen Risiken dieser recht neuen Technologien. Neben dem Klimaschutz müssen daher auch andere wichtige gesellschaftliche Ziele, beispielsweise der Schutz der Biodiversität, Natürlicher Wasserhaushalt, Grundwasserschutz in der Planung berücksichtigt werden.
Quelle: NABU
Mehr Informationen zum Thema unter:
https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/energie/erneuerbare-energien-energiewende/35360.html