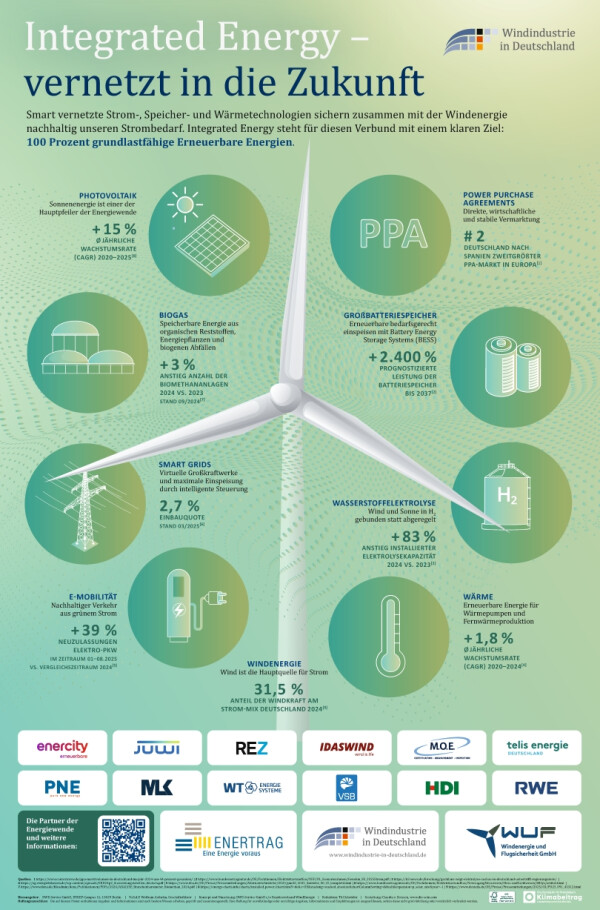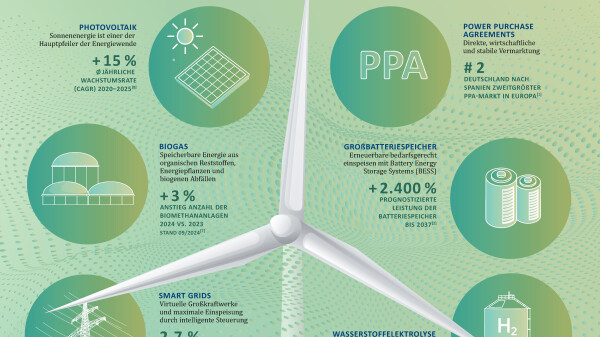Der Beitrag der Bioenergie zur Treibhausgasneutralität – Umfrageergebnisse des TRANSBIO-Projekts

Ein Ziel von TRANSBIO ist es, die Ergebnisse und zentralen Handlungsempfehlungen der verschiedenen sog. Post-EEG-Forschungsprojekte zu vergleichen und über geeignete Kanäle zu publizieren . Das zweite Ziel dient der Verbesserung der Kommunikation zwischen Bioenergiefachleuten sowie Experten und Stakeholdern der Energiewende, die nicht tagtäglich mit Bioenergie befasst sind (Energieexperten).
Für das zweite Ziel wurde ein strukturierter Dialogprozess aufgesetzt. Dieser bestand aus zwei Dialogforen sowie mehreren Online-Befragungen.
Delphi-Umfrage zur künftigen Rolle der Bioenergie
Prozess und Methodik, Fragetechnik
Bei einem (online-) Dialogforum im Februar 2022 wurden Fokusgruppen-Interviews zur Leitfrage „Welche Rolle kann oder sollte Bioenergie (Biogas und feste Biomasse) auf dem Weg zur THG-Neutralität spielen?“ durchgeführt. Es wurden Fokusgruppen zu drei energiesystembezogenen Themenbereichen (Strom, Wärme, Gas- und Treibstoffmarkt) sowie zu drei übergreifenden Themenbereichen (Landwirtschaft, feste Biomasse/Forstwirtschaft, biogene Rest- und Abfallstoffe) gebildet.
In fünf Gruppen wurden von den Teilnehmern Aussagen zu „Chancen“ und zu „Risiken“ erarbeitet und im Plenum zusammengetragen. Für den Themenbereich „biogene Rest- und Abfallstoffe nach Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)“ kam mangels Beteiligung keine Fokusgruppe zu Stande. Anschließend sollte herausgefunden werden, inwiefern die erarbeiteten Aussagen den Konsens unter den Expertengruppen widerspiegeln.
Dafür wurde im weiteren Verlauf aus den Aussagen der Fokusgruppeninterviews ein (online-) Fragebogen erstellt und mehrere Fragerunden mit unterschiedlichen Zielgruppen durchgeführt. Die erste Umfrage im April 2022 wandte sich an die Mitglieder des o.g. Dialogforums und an die Mitglieder einer komplementären Projektarbeitsgruppe aus Bioenergiefachleuten. Die zweite Runde fand im Juni 2022 statt. Um die Ergebnisse weiter zu konsolidieren, wurde die Umfrage erneut mit einer größeren Zielgruppe durchgeführt. Der (leicht modifizierte) Fragebogen wurde an große, einschlägig bekannte email-Verteiler (Strommarkttreffen , Grüne-Gase-Gruppe , Wärmesektor ) geschickt. Hier fand die erste Runde im September 2022 und die zweite im Januar 2023 statt.
Die Gestaltung des Prozesses mit mehreren Fragerunden folgte dem sog. „Delphi-Format“. Dabei wird nach der ersten Fragerunde der (anonymisiert) ausgewertete Fragebogen erneut an die Teilnehmer gesendet, mit der Bitte, diesen angesichts der Ergebnisse der „Schwarmintelligenz“ nochmals auszufüllen. So können die Teilnehmer die (Nicht-) Übereinstimmung der eigenen Bewertungen im Vergleich zur Gruppenmeinung der Experten prüfen und ggfs. anpassen. Damit kann die eigene Meinung auch gegen die Gruppenmeinung der eigenen Expertengruppe („peer group“) angepasst werden.
Über alle Umfragen hinweg ergaben sich 148 gültige Fälle. Jeder Teilnehmer musste eine Selbsteinschätzung seiner Expertise als „Experte“, „sachverständig“, „vertraut“ oder „gering vertraut“, entweder für „Bioenergie“ oder für „allgemeine energiewirtschaftliche Fragestellungen“ abgeben. Für die Bioenergie haben sich 40 % als Experte und 52 % als sachverständig bezeichnet, für Teilnehmer aus der allgemeinen Energiewirtschaft 12 % und 41 %; d.h. aus der „Bioenergie-Szene“ nahmen mehr aktiv Forschende an den Befragungen teil.
Basierend auf der Auswahl und Gewichtung aus den Fokusgruppen wurden den Teilnehmenden im Fragebogen zu jedem Themenbereich zehn Aussagen präsentiert. Für den Themenbereich „biogene Rest- und Abfallstoffe […]“ wurden durch die Teilnehmenden in der ersten Runde mit Hilfe von Freitextfeldern zehn Aussagen generiert. Im Rahmen einer „Zustimmungsfrage“ sollten die Aussagen zunächst in fünf Stufen (von „überhaupt nicht“ bis „voll und ganz“) bewertet werden, die fünf wichtigsten Aussagen sollen im Rahmen einer „Rankingfrage” ausgesucht werden (ranking 1-5).
Im Mai 2023 fand das finale Dialogforum in Präsenz statt. Hier wurden die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Dafür wurden für jeden Themenbereich mit Blick auf Zustimmung und Wichtigkeit die 3-4 priorisierten Aussagen anhand statistischer Tests identifiziert und eventuelle Unterschiede im Antwortverhalten der Energieexpertengruppen dargestellt.
Im Folgenden werden für die jeweiligen Themenbereiche nur die prioritären Aussagen präsentiert, die in den Umfragen insgesamt statistisch signifikant höhere Zustimmungswerte erzielten bzw. als besonders wichtig eingestuft wurden.
Die Rolle der Bioenergie im Energiesystem
Im Frageblock zum Stromsystem wurden folgende Aussagen als prioritär bewertet:
Eine flexible Fahrweise bietet die Chance zum Ausgleich fluktuierender erneuerbarer Energien.
Anreizsysteme für Bioenergie (z.B. EEG) sollten in Richtung gesicherter BHKW-Leistung und flexibler Fahrweise weiterentwickelt werden.
Die Bedeutung der Leistungsbereitstellung durch Bioenergie zum Ausgleich fluktuierender Stromerzeugung nimmt zu.
Besonders Bioenergiefachleute mit – nach eigener Einschätzung – hoher Expertise schätzen die Bedeutung der flexiblen Fahrweise zum Ausgleich des Stromsystems tendenziell höher ein als die Energiefachleute.
Im Frageblock zum Wärmesystem wurden folgende Aussagen als prioritär bewertet:
Die Nutzung von Rest- und Abfallstoffen zur industriellen Prozesswärmebereitstellung hat einen sehr hohen Klimaschutzbeitrag.
Die notwendige Sektorkopplung begünstigt eher strombasierte Wärmesysteme.
Hybridkonzepte mit Bioenergie bieten im Wärmebereich die Chance, Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
Hier lagen die Unterschiede zwischen Energieexperten und Bioenergiefachleuten bei der letzten Aussage. Bioenergiefachleute sehen die Aussage häufiger als wichtig an.
Im Frageblock zum Gas- und Treibstoffmarkt unterschieden sich vier Aussagen in der Bewertung durch die Experten signifikant von den übrigen und wurden als prioritär bewertet:
Die Frage der Gesamtmenge an Bioenergie mit den Folgen für Landnutzung und Biodiversität ist zu klären.
Biomethan ist eine Kohlenstoff-Quelle und ein multifunktioneller Energie- und Grundstoffträger für industrielle und andere Anwendungen.
Biomethan kann als saisonaler Speicher für den Winter für verschiedene Anwendungen genutzt werden.
Innerhalb des Transportsektors bestehen Nutzungskonkurrenzen. Die Verwendung grüner Gase für LKW und Schiff sollte ggü. PKW priorisiert werden.
Unterschiedliche Bewertungen gab es bei der ersten Aussage: Energieexperten stimmten dieser Aussage im Unterschied zu Bioenergiefachleuten häufiger zu, scheinbar ist diese Frage für die Energieexperten noch zu klären, was für Kommunikationsbedarf spricht.
In den energiesystembezogenen Themenblöcken bezogen sich die Diskussionen des finalen Dialogforums auf übergreifende Aspekte und werden weiter unten dargestellt.
Die Rolle der Bioenergie jenseits des Energiesystems
Im Folgenden werden über das Energiesystem hinausgehende Effekte angesprochen, die auch im finalen Dialogforum diskutiert wurden.
Im Bereich „Biogas und Landwirtschaft“ wurden drei Aussagen als prioritär bewertet: (1) der Beitrag zur THG-Minderung und zur Verwertung von Reststoffen (Wirtschaftsdünger), (2) die Verwendung der Gärreste als Stickstoffdünger (v.a. im Ökolandbau) und (3) eventuelle negative Einflüsse auf die Biomasseverfügbarkeit durch Klimawandelrisiken. Hier wurden die ersten beiden Aussagen von Bioenergiefachleuten häufiger als wichtig angesehen als von Energieexperten. In den Ergebnissen der Umfrage erhielt die Aussage: „Landwirtschaft ist eine erneuerbare Kohlenstoffquelle und dient als Ankoppelstelle für erneuerbaren Wasserstoff für klimaneutrale Kohlenwasserstoffe“, deutlich geringere Zustimmungswerte und wurde nur 22-mal als eine der wichtigsten Aussagen angesehen. Dies ist bemerkenswert, da im finalen Dialogforum erneut die potentielle Kohlenstoffsenke als ein Alleinstellungsmerkmal betont wurde. Für die Landwirte sei in der Kommunikation der unmittelbare Nutzen als erneuerbare Kohlenstoffquelle stärker zu betonen.
Im Bereich „feste Biomasse und Forstwirtschaft“ wurden die drei Aussagen zur Notwendigkeit einer verlässlichen Zertifizierung, zum ökonomischen Wert des Waldes und des Holzes als Kohlenstoffe-Senke sowie die zukünftige Substitution anderer Baustoffe (Beton, Stahl) durch Holz priorisiert. Diese Aussagen werden von Bioenergiefachleuten häufiger als wichtig angesehen. Im finalen Dialogforum wurde diskutiert, dass die Nutzung fester Biomasse in der Einzelraumfeuerung („Kamin“) abnehmen sollte und ein Transformationsplan für das Auslaufen von Holz in Kaminöfen diskutiert. Diese Aussage war auch in den Statements enthalten, wurde aber von beiden Gruppen als ambivalent und wenig wichtig bewertet.
Schließlich wurden im Bereich „biogene Rest- und Abfallstoffe nach dem KrWG“ vier Aussagen als prioritär bewertet. Auch diese Aussagen stuften die Bioenergiefachleute häufiger als wichtig ein. Sie beziehen sich auf die unbedingte Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe zur energetischen Nutzung des darin enthaltenen Kohlenstoffs sowie die Verdrängung fossiler Energien und Verbesserung der THG-Bilanz durch deren Nutzung. Eine weitere prioritäre Aussage bemängelt, dass die fehlende Klarheit gesetzlicher Definitionen die energetische Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe erschwert. So führen z.B. gesetzliche Definitionen zum Ausschluss verschiedener Abfälle für die energetische Verwertung. Schließlich wurde das Potential regionaler Wertschöpfung durch die Nutzung von Landschaftspflegematerial als prioritär bewertet. Dies wurde im finalen Dialogforum vertieft, u. a. wurden Probleme mit der Definition von Regionalität (z.B. Brandenburg und Berlin getrennt vs. zusammen) und Wissensdefizite – und somit Forschungsbedarf – z.B. bei der Nutzung von Straßenbegleitgrün konstatiert.
Ergebnisdiskussion und Reflektionen im finalen Dialogforum
Im finalen Dialogforum wurden die Ergebnisse sowie Forschungs- und Kommunikationsbedarfe übergreifend diskutiert und auf Metaplanwänden/Pinnwänden gesammelt. Am Schluss der Veranstaltung erhielten die Teilnehmenden Klebepunkte, um die aus ihrer Sicht wichtigsten Forschungs- und Kommunikationsbedarfe zu priorisieren.
In der Diskussion während des finalen Dialogforums wurden mit Blick auf den Forschungsbedarf die Interdependenzen zwischen den Sektoren betont. Generell sollten z.B. die Wechselwirkungen zwischen energetischer und stofflicher Nutzung, biobasierte Wertschöpfungsketten sowie die Nutzungseffizienz stärker beachtet werden. Dabei könnten sich land- und forstwirtschaftliche Themenbezüge auch als Restriktionen auf die Nutzung im Energiesystem auswirken.
Das Thema der saisonalen Stromerzeugung wird aus Sicht der Teilnehmer zukünftig weiter an Bedeutung für die Bioenergie gewinnen, da fluktuierende EE auch eine ausgeprägte Saisonalität haben. Dabei sollten die Möglichkeiten der intelligenten Einbindung mit anderen erneuerbaren Energien (flexibler Einsatz als Spitzenlast, in Wärmenetzen/in KWK, Interaktion mit Stromsystem) stärker adressiert werden.
Im Bereich des Gas- und Treibstoffmarktes war die Frage der Erdgasinfrastruktur ein dominantes Diskussionsthema. So wurde Forschungsbedarf bei den gegensätzlichen Positionen „Weiternutzung“ (mit veränderten Einspeise- und Nutzungsprofilen) vs. „Rückbau“ identifiziert. In dem Zusammenhang stellen sich Fragen nach realistischen Mengen an erneuerbaren Gasen, notwendigen (Netz-) Technologien, Vermeidung von Pfadabhängigkeiten durch Infrastruktur-Entscheidungen und dem Einfluss eines strategischen Verhaltens der Gasnetzbetreiber.
Im Verkehrssektor wurde die THG-Vermeidung und die daraus entstehenden Nutzungskonkurrenzen mit Blick auf die Bioenergie diskutiert. Aus Sicht des Dialogforums führt v.a. die Regulierung (THG-Quotenhandel) zu einer deutlich höheren Zahlungsbereitschaft. Forschungsbedarf bzgl. Nutzungskonkurrenzen und des möglichen Einsatzes von Biomasse im Treibstoffsektor wurden festgestellt. Gleichzeitig wurde betont, dass der Verkehr ohne Biomasse nicht defossilisiert werden kann.
Forschungsbedarf wurde mit Blick auf THG-Minderungsraten auch in landwirtschaftlichen Prozessen (Lachgasemissionen, Biokohleprodukte) sowie die Auswirkung der stofflichen Nachfrage auf die Biomasseverfügbarkeit gesehen.
Im Hinblick auf Rest- und Abfallstoffe waren Zertifizierungssysteme ein neuer Punkt. Diese seien zwar vorhanden, aber in der Fläche schwierig umzusetzen. Dabei treten eine Reihe von Herausforderungen auf (Heterogenität, Kleinteiligkeit, Saisonalität von Abfällen) und daraus folgend die Frage nach Reststoffpotentialen. Schließlich wurde mehrfach auf die Notwendigkeit einer besseren Verlässlichkeit von Zertifizierungssystemen und – als Forschungsbedarf – deren wissenschaftliche Evaluation hingewiesen.
Mit Blick auf Kommunikation wurde die Notwendigkeit zielgruppenspezifischer Veranstaltungsformate (z.B. parlamentarische Abende) sowie Veranstaltungs- und Informationsformate für ein breiteres Publikum (Themenabende, Fachdiskussionen) hervorgehoben.
Informationsdefizite in der Öffentlichkeit und bei Endnutzern und damit Kommunikationsbedarfe lägen z.B. bei:
mangelnder (aber notwendiger) Differenzierung unterschiedlicher Technologien und Größenklassen (z.B. Schadstoffemissionen und Effizienz bei Einzelraum- vs. Großfeuerung);
Bedeutung hoher Energiedichten;
Komplexität landwirtschaftlicher Themen und praxisrelevanter Kernbotschaften;
Begrifflichkeiten und Definitionen der Forstwirtschaft (Kohlenstoff-Senke, -vorrat);
Importanteile von Holz nach Deutschland zur energetischen Verwertung.
Insgesamt sei eine größere Interdisziplinarität und Kommunikation zur flexiblen Bioenergienutzung im Kontext des verfügbaren Bioenergiepotentials notwendig.
Fazit
Die Ergebnisse der Befragung haben sich insgesamt als stabil erwiesen. Auch die veränderten Rahmenbedingungen während der Energiekrise haben nicht zu einer wesentlichen Änderung des Antwortverhaltens geführt.
Bemerkenswert ist, dass im finalen Dialogforum einige Themen verstärkt diskutiert wurden, die in der Umfrage von der Mehrheit als weniger wichtig eingestuft worden sind. Dies mag an der Zusammensetzung des Dialogforums liegen. Zwar wurde über breite Verteiler eingeladen, aber Personen, die der Bioenergie kritisch gegenüberstehen könnten, waren weniger vertreten.
Zusammenfassend können aus dem Dialogprozess folgende Schlussfolgerungen für die künftige Rolle der Bioenergie gezogen werden:
Im Bereich Strom sollte der Fokus der Bioenergie auf der Backup-Funktion für die fluktuierenden erneuerbaren Energien (Windkraft und PV) liegen. Im abschließenden Voting des Dialogforums zum Forschungsbedarf lag der Schwerpunkt v.a. beim saisonal differenzierten Betrieb und der systemischen Betrachtung.
Im Bereich Wärme sollte der Fokus der Bioenergie einerseits auf den strategischen Schlüsselbereichen (z.B. Prozesswärme) und der Versorgungssicherheit liegen. Dabei werden auch die begrenzte Rolle der Bioenergie und die Notwendigkeit des effizienten Einsatzes betont.
Im Bereich Gas und Treibstoff wurde angebotsseitig auf die begrenzte umweltverträgliche Gesamtmenge verwiesen. Nachfrageseitig wird die Multifunktionalität in energetischen Anwendungen und darüber hinaus (Grundstoffchemie) betont.
Im Bereich Biogas und Landwirtschaft wird die Multifunktionalität von Biogas (THG-Minderung und Produktion von Düngern) und gleichzeitig die Vulnerabilität gegenüber Klimawandelrisiken hervorgehoben.
Im Bereich feste Biomasse und Forstwirtschaft liegt der Schwerpunkt auf der Notwendigkeit einer verlässlichen Zertifizierung, der Wertigkeit holzartiger Biomasse als C-Senke und als Baustoff.
Schließlich rückt im Bereich biogene Rest- und Abfallstoffe nach dem KrWG die Bedeutung der energetischen Nutzung biogener Rest- und Abfallstoffe in den Fokus.
Übergreifend weisen die Umfrage und das finale Dialogforum auf einen starken Kommunikationsbedarf mit der Forderung an die Politik nach konsistenten, transparenten und langfristigen Rechtsnormen. In wesentlichen Aspekten herrscht Konsens zwischen den Energie- und Bioenergiefachleuten. Es fehlt aber grundlegendes Verständnis für die komplexen Zusammenhänge in Medien und Politik. Hier muss die Energiebranche gemeinsam klarer kommunizieren und aufklären.
In dem Artikel wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit ausschließlich das generische Maskulinum verwendet. Es bezieht sich auf alle Geschlechter.
Autoren:
Dr. P. Matschoss, wiss. Mitarbeiter
Prof. Dr. K. Gapp-Schmeling, assoziierte Professorin, IZES gGmbH, Berlin
B. Wern, Arbeitsfeldleiter IZES gGmbH, Saarbrücken
Kontakt: matschoss@izes.de
- Z. B.: Matschoss, P.; Wern, B. (2024): Die Bioenergie in der Energiewende und die „Post-EEG-Frage“. Eine Synopse von Post-EEG-Studien. IZES-Schriftenreihe 24/1.
- https://www.strommarkttreffen.org/
- https://www.greengasadvisors.de/experts/index.html
- https://www.listserv.dfn.de/sympa/subscribe/waermesektor?previous_action=signoff